Morse, Steve: Dieser Name fällt immer ganz beiläufig, raunend fast, wenn man dezent mit fachlicher Kompetenz glänzen möchte. Nicht nur in Insiderkreisen. Morse, so viel steht fest, gilt als einer der besten, ja von 1982 bis 1986 sogar als der beste, aufblitzend aus einer Vielheit der Allroundgitarristen, Steve ist zudem eine Integrationsfigur, ein Grundsympath, mit dem sich auch die nicht allzu glühenden Verehrer des Gitarrensports arrangieren können, und dennen bei Nennung des Namens von Ritchie Blackmore meist nur einfällt, was das doch für eine Flitzpiepe sei.
Der langmähnige Steve begann mit den Dixie Dregs (ab 1981 Dregs) den aufregenden Geist einer Mischung aus Jazz, Country, Folk und Rock zu destillieren, lieferte sich auf „Industry Standard“ (1982) in bester Fusionmanier Zweikämpfe mit Gastgeiger Mark O’Connor und Arschgei... Pardon! Gastgitarrist Steve Howe, folgte einer Prophezeihung der Hopi-Albaner und formierte alsbald ein unikates Trio namens Steve Morse Band. Frank Schäfer behauptet, noch heute das grandiose „Cruise Misslile“, den Opener von „The Introduction“ (1984) komplett und fehlerfrei nachpfeifen zu können. Steve verteilte eine Unzahl von Pickups nach scheinbar strömungsmechanischen Prinzipien über seine Telecaster und folgte 1986 Phil Eharts Einladung zu Kansas.
Mit „Power“ (1986) lieferte die Combo eine Lehrvorführung in Sachen amerikanische Hardrock ab. Die Stücke gerieten konzis und packend, und oft haben sich treue Kansas-Fans gefragt, wo bei all den klug gemixten Aufnahmen Secondhandgitarrist Rich Williams abgeblieben sein könnte. Der Nachfolger „In The Spirit Of Things“ (1988) zeigte deutlich mehr Radioappeal einerseits und olle Artrockverschmiemeltheit andererseits, kurzum stilistische Orientierungsschwierigkeiten allewege. Ein eben erst offiziell erschienener Livemitschnitt dokumentiert trotzdem, welche aufregende Klasse die Band während ihrer konzertierter Aktionen besaß. Man trennte sich, und Steve formierte abermals ein Trio von seltener Schön- und Klarheit. „High Tension Wires“ (1989) und „Structural Damage“ (1995) liegen uns als Beweismaterial vor.
Immer häuften sich Zurufe etwa folgenden Inhalts: „Steve, du bist der Größte!“ Gut placiert in diesem Chor: Ian Gillan und Jon Lord, die ihn dieserart auch für Deep Purple geködert haben. Und was das Gros der Fans nicht für möglich gehalten hätte, trat ein: Steve schaffte es, mit morsezeichenähnlichen, rasant-rasenden Phrasierungen auf seiner blauen Music Man Silhouette Gitarre (und den dazu passenden Turnschuhen), selbst wichtigsten Blackmore-Wirkungsherden neues Leben einzuhauchen, ohne das Deep Purple das Risiko eingehen musste, zur Country-Kapelle zu mutieren. Man höre die Gitarre-Orgel-Duelle bei „Speed King“ oder das gänsehäutende Solo zu „When A Blind Man Cries“ (beide „Live At The Olympia“, 1996), von dem sich der sonst für derlei Melodienkunst prädestiniert fühlende Gitarrenwilli David „Dave“ Gilmour mal die Marschrichtungszahlen vorgeben lassen sollte. – Schöne Nebenwirkung: Deep Purple wuchs wieder zu einer richtigen Band zusammen. Damit aber nicht der Eindruck entsteht, hier würde ausschließlich über den grünen Klee gelobt, sei an dieser Stelle geschickt die Überleitung zur freilich winzigen Meckerecke installiert. Nach mehreren Platten, im Block hintereinander gehört, nerven mitunter die Obertöne, die er durch das um 12 Bünde versetzte Parallelspielen mit Anschlag- und Greifhand erzeugt. Wir wiederholen: mitunter. Aber angesichts der gigantischen, fast möchte man behaupten: titanischen Gitarrenanstrengungen ein, sagenwa, lässliches Vergehen. Eigentlich nicht der Rede wert. Am besten vergessen Sie’s ganz schnell wieder.
Also, das wars dann.
Gruß
Joachim


 , aber mir geht es dabei, wie wenn ich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ansehen soll - aber auch aus diesem Oscarverdächtigen Meisterwerk sind schließlich schon Hitparadenstürmer entsprungen
, aber mir geht es dabei, wie wenn ich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ansehen soll - aber auch aus diesem Oscarverdächtigen Meisterwerk sind schließlich schon Hitparadenstürmer entsprungen  !
Aber vielleicht schreibe ich jetzt auch ein Buch "Interplanetare Kernfusion in der Edelgasschicht des Ozonlochs" - ich verstehe zwar nichts davon, aber vielleicht kann ich den Unterhaltungswert der belletristischen Kulturlandschaft beleben, denn schließlich hat's auch Dieter Bohlen mit seiner Bio als Nummer 1 der Verkaufstistiken geschafft
!
Aber vielleicht schreibe ich jetzt auch ein Buch "Interplanetare Kernfusion in der Edelgasschicht des Ozonlochs" - ich verstehe zwar nichts davon, aber vielleicht kann ich den Unterhaltungswert der belletristischen Kulturlandschaft beleben, denn schließlich hat's auch Dieter Bohlen mit seiner Bio als Nummer 1 der Verkaufstistiken geschafft  , nachdem er uns schon jahrzentelang mit seinen musikalischen Meisterwerken erfreut!
Kulturelle Grüße aus Wien
Michael
, nachdem er uns schon jahrzentelang mit seinen musikalischen Meisterwerken erfreut!
Kulturelle Grüße aus Wien
Michael
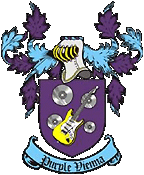
 Wie man sieht war aber diese Fleißarbeit nicht umsonst,sondern hat doch zum Meinungsaustausch geführt.
Wie man sieht war aber diese Fleißarbeit nicht umsonst,sondern hat doch zum Meinungsaustausch geführt.